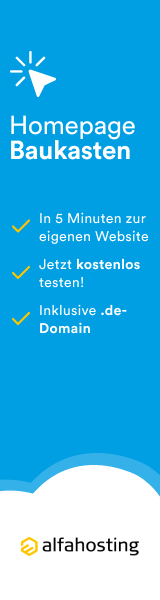zeitgeist auf Telegram
Das aktuelle Heft
Edition H1 (Kunstbuch)
Die 10 neuesten Onlinebeiträge
- Kommt Zeit, kommt Mut
- Faschismus in Europa im Zusammenhang denken: bahnbrechende Dokumentation bei RT
- Meinungsfreiheit und Pressefreiheit zur Disposition
- Deutsches Reich – von Versailles bis Versailles
- „Heil dir im Siegerkranz“ – zur Gründung des Deutschen Reiches am 18. Januar 1871
- Der beschädigte Nimbus: Fälschung, Betrug und Streit in der Wissenschaft
- Vom Tag der Deutschen Einheit zum Tag des Zorns
- Regime Change in Belarus?
- Berlin im August 2020: Hört auf die Menschen!
- Hochhuth – der zwiegespaltene Rebell
Der beschädigte Nimbus: Fälschung, Betrug und Streit in der Wissenschaft
- Mittwoch, 28. Oktober 2020 15:48
Von Prof. Dr. phil. HARTMUT HEUERMANN
Im Gegensatz zum Berufsstand des Politikers – und jüngst auch des Journalisten – genießt der des Wissenschaftlers noch einen guten Ruf. Man begegnet der Zunft weithin sogar mit Ehrfurcht. Doch genau da liegt die Tücke: Zum einen hemmt naive Wissenschaftsgläubigkeit die Aktivierung des eigenen gesunden Menschenverstands. Zum anderen ist Wachsamkeit gefordert, denn Forschungsskandale und Verfehlungen einzelner Vertreter lassen den Nimbus mehr und mehr erodieren. Der Kulturwissenschaftler Hartmut Heuermann analysiert die Umstände und gibt markante Beispiele.
Die Wissenschaft als Teilsystem des gesellschaftlichen Gesamtsystems ist in der westlichen Zivilisation von einem Nimbus umgeben − dem Nimbus hehrer Wahrheit, profunder Erkenntnis und willkommenen Fortschritts. Selbst in einer Zeit, da aufgrund der offenkundigen Janusköpfigkeit wissenschaftlichen Denkens und Handelns wachsender Zweifel den Glorienschein spürbar verdunkelt, ist die Wissenschaftsgläubigkeit des abendländischen Menschen ein Phänomen, das durch um sich greifende Skepsis offensichtlich nicht so gelitten hat, dass es allenthalben kollektiver Ernüchterung gewichen wäre. Wenn es in den Medien heißt: „Die Wissenschaft hat herausgefunden“; „Forscher stellten fest“; „Experten konnten zeigen“; „Neuere Studien beweisen“, sind weite Teile der Öffentlichkeit noch immer zu lauschen bereit, als würden sie höherer Offenbarungen teilhaftig. Derartige Verlautbarungen haben Kredit, sie genießen Aufmerksamkeit aufgrund eines Vertrauensvorschusses der Wissenschaftler, den die meisten anderen Berufsgruppen so nicht genießen.
Wahrheit – obwohl obgleich erkenntnistheoretisch der heikelste aller Begriffe − stellt in der Wissenschaft einen hohen Wert dar
Dieser Nimbus hat verschiedene, sowohl geschichtliche als auch aktuelle Gründe: Kulturhistorisch ist der Wissenschaftler ein später Nachfahre der vormaligen Zunft der Magier, Schamanen, Alchimisten, Priester und Scholaren; die Zugang zu einer Art esoterischen, oftmals göttlichen Wissens beanspruchten, das Menschen mit plattem Hausverstand verborgen blieb. Dieses kulturelle Erbe wirkt in den verschiedensten Disziplinen nach:
- theologisch ist der Wissenschaftler ein Gelehrter, der sich auf die Auslegung sakraler Schriften versteht und sich berufen fühlt, als ein Mittler zwischen Himmel und Erde, Gott und Mensch, Transzendenz und Immanenz aufzutreten;
- philosophisch gilt er als ein Sucher nach hehren Wahrheiten, die zu finden und zu entwickeln ihm idealistische Gesinnung und scharfen Intellekt abverlangen;
- medizinisch wird er als ein Heiler mit kurativen Fähigkeiten verehrt, von dem sich die Menschen Gesundung von ihren Krankheiten und Erleichterung bei ihren Gebrechen erhoffen;
- psychologisch verkörpert er einen Fachmann mit besonderem Einfühlungsvermögen in seelische Probleme, die er bei Genies mit exzeptioneller Begabung ebenso erkundet wie bei Menschen mit fortgeschrittener Demenz;
- soziologisch ist der Wissenschaftler der Repräsentant eines Phänotyps, der uns Auskunft gibt über die Hintergründe gesellschaftlicher Veränderungen und die Gründe sozialer Konflikte;
- ökonomisch ist er der Urheber von Erkenntnissen, die dem analytischen Verständnis von Wirtschaftsprozessen dienen und den Weg ebnen zu wirtschaftlich verwertbaren, produktionssteigernden Maßnahmen;
- technologisch ist er der Innovator von allerlei Artefakten, Apparaten und Maschinen, die industrielle Fertigungstechniken verbessern und mit rationalisierten Verfahren Arbeit und Leben erleichtern;
- Und naturwissenschaftlich ist er ein Analytiker und Erklärer komplexer Vorgänge, die im Kosmos und auf der Erde walten und die Gesetzmäßigkeiten in der Welt der Natur bestimmen.
Kurz: Der Wissenschaftler ist eine intellektuell und sozial herausgehobene Person, die der Menschheit zur Verbreitung von Wissen dient und sie zur Anwendung von nützlichen Verfahren leitet.
Die Meinungsforscherin Elisabeth Noelle-Neumann vom Institut Allensbach hat bei einer Umfrage zum Status von Forschern und Professoren von einer „geheimnisvollen Sympathie“ gesprochen, die die Öffentlichkeit für die Wissenschaftler hegt1 −, eine Sympathie, die so geheimnisvoll auch wiederum nicht sein kann, berücksichtigt man die wissenschaftlichen Leistungen und Erfahrungen als Summe ihrer historischen Wirkung. Jedenfalls hat sich aus der Bündelung von Respekt einflößenden Errungenschaften und Problem lösenden Arbeiten eine Aura gebildet (57 % der von Allensbach Befragten hatten eine „gute Meinung“ von Wissenschaftlern und Professoren), die auf dem erwähnten Vertrauensvorschuss beruht. Im Glorienschein ihrer Reputation sonnen sich so manche Vertreter der wissenschaftlichen Zunft, insbesondere diejenigen, welche sich revolutionärer Fortschritte in ihren Disziplinen rühmen dürfen (gefeierte Nobelpreisträger, internationale Bestseller, weithin anerkannte Koryphäen). Aber, wie sich zeigen lässt, ist die Reputation nur partiell mit verdienter Autorität und unbezweifelbarer Kompetenz erklärbar, denn sie spiegelt auch Einflüsse, die jenseits der Wissenschaft im engen Wortsinn liegen – Einflüsse wie Tradition, Status, Idealbild, Hierarchie, Käuflichkeit, Dominanz und Macht.
Da diese Aura existiert, wird es von der Profession als besonders peinlich und blamabel empfunden, wenn sich in ihren Reihen Betrüger tummeln, die in den Heiligtümern des Wissens das Menschlich-Allzumenschliche der Gattung hervorkehren und den Nimbus beschädigen. Wahrheit – obgleich erkenntnistheoretisch der heikelste aller Begriffe − stellt in der Wissenschaft einen hohen Wert dar, und ihr ethisches Derivat, die Wahrhaftigkeit, verträgt sich nicht mit Täuschungsmanövern und betrügerischen Machenschaften, wie sie in den letzten Jahrzehnten gehäuft vorgekommen sind. In solchen Fällen trifft die Idealität des beruflichen Ethos hart auf die Realität der wissenschaftlichen Praxis. Die Kollision erzeugt Schocksymptome in der scientific community, oft sogar in der weiteren Öffentlichkeit: ungläubige Verwunderung, stille Beschämung, evasorische Verdrängung, hartnäckige Leugnung, laute Empörung, öffentliche Verurteilung − so ziemlich alle Reaktionen der Betroffenheit, die Menschen zeigen, deren Welt- und Selbstbild empfindlich angekratzt wurde.
Täuschung im wissenschaftlichen Leben gilt als Angriff auf das Ethos eines höchst respektablen Berufs
Täuschung im wissenschaftlichen Leben gilt als Angriff auf das Ethos eines höchst respektablen Berufs. Sie wird als gravierender empfunden als Täuschung im sozialen oder politischen Leben, weil hier die Fallhöhe vom Sockel normativer Ansprüche zum Boden normverletzende Fakten größer ist als dort. Betrug in der Wissenschaft untergräbt das Phänomen, das William Broad und Nicholas Wade als den „Mythos der Logik“ bezeichnen,2 d. h. den kollektiven Glauben an die Unfehlbarkeit von Menschen, deren professionelles Tun mutmaßlich vom reinen Logos geleitet wird und die man insofern über kriminelle Neigungen und „unreine“ Versuchungen erhaben wähnt. Indes − bestünde eine solche Resistenz, gäbe es weder die skandalösen Betrügereien von Wissenschaftlern, die im Forschungsbetrieb skrupellos mogeln, noch die heftigen Kontroversen unter Experten, die unerschütterlich auf ihre eigene Kompetenz pochen. Drei Beispiele:
Ein eklatanter, zugleich amüsanter Fall, betrifft die Entdeckung des sogenannten Piltdown-Menschen. Dabei handelt es sich um die plumpe paläologische Fälschung eines als hochbedeutsam ausgegebenen Fossilienfundes, der Anfang des 20. Jahrhunderts in einer Kiesgrube in Piltdown, einem Dorf im Südosten Englands, getätigt wurde.3 Entdecker war der Rechtsanwalt Charles Dawson, dessen Fund den Namen eonanthropos dawsoni erhielt. Der Sensation der Ausgrabung und seiner öffentlichen Wirkung kam folgender Umstand zugute: Viele Viktorianer waren zu Beginn des 20. Jahrhunderts der selbstschmeichlerischen Auffassung, dass die englische Insel im Paläolithikum die Wiege der Weltzivilisation gewesen sei. Nur fand man dafür lange Zeit keine wissenschaftlichen Beweise. Wichtige Belege für das menschliche Frühzeitleben wurden damals in Deutschland und Frankreich gefunden, nicht aber in England. Als 1912 in der Kiesgrube ein Menschenschädel mit einem affenartigen Kiefer entdeckt wurde, schien eine Sensation perfekt. Die Enthusiasten unter den Paläologen verbreiteten die Nachricht, man habe mit dem Schädel endlich das fehlende Glied, die Übergangsform vom Menschenaffen zum Menschen, in der Hand. Fachleute, die darauf hinwiesen, dass Schädel und Kiefer nicht zusammenpassten, wurden ignoriert. Ein skeptischer Anthropologe, Wilfrid Le Gros Clark, der Manipulation witterte, versuchte, das Betrugsmanöver auf listige Art zu enttarnen: Er feilte einen Affenzahn so zurecht, dass er an die Stelle eines fehlenden Zahns im Gebiss des Piltdown-Menschen passte und ließ ihn in der Kiesgrube vergraben. Tatsächlich wurde der Zahn gefunden, eingepasst und als Bestätigung des Piltdown-Menschen gefeiert, obwohl augenfällig war, dass man grob daran gefeilt hatte. Der Zoologe ersann daraufhin ein anderes Mittel und deponierte eine noch plumpere Fälschung. Aus einem Elefantenknochen schnitzte er als „typisches Utensil“ eines Engländers einen Cricket-Schläger. Auch dieser wurde natürlich gefunden und als ein Beispiel für die bemerkenswerten Fertigkeiten des Frühzeitmenschen gefeiert. Fachkundige Paläologen hätte merken müssen, dass es im Tertiär kein Werkzeug gegeben hat, mit dem man einen Knochen dergestalt hätte bearbeiten können. Doch die Debatte unter Fachleuten währte Jahrzehnte. Der entnervte Zoologe gab schließlich auf. Erst im Jahr 1953, als Funde in Afrika Menschenschädel mit Affenkiefer statt affenartiger Schädel mit Menschenkiefer zutage förderten, und erst als moderne Datierungsverfahren (Carbon-14-Methode) die Fälschung zweifelsfrei nachwiesen, verschwand der Piltdown-Mensch von der Bildfläche.

England als Wiege der Menschheit? Der vermeintliche Beweis, der sogenannte Piltdown-Mensch (im Bild als Büste aus dem Jahr 1915), stellt sich später als Fälschung heraus (Quelle: Welcome Collection/Wikimedia Commons)
Dass hier der Wunsch der Vater des Gedankens war, ist allzu offensichtlich. Wunschdenken kann Gewissen zum Schweigen und Verhaltensnormen zum Verschwinden bringen. Wunschdenken ist der große Blender gegenüber einer nüchternen, vielleicht oft allzu nüchternen Forschungswirklichkeit. Es ist der Hauptmotivator für wissenschaftliche Manipulation, wobei die Wünsche ein Spektrum verschiedener Motive bilden, die von individueller Ruhmsucht über objektiven Leistungs- und Erwartungsdruck bis zu allgemein weltanschaulichen Projektionen reichen. Jedenfalls wird dann, wenn Wünsche per Manipulation Wirklichkeit werden sollen, der Versuch unternommen, Kongruenz zu stiften zwischen Selbstbild und Wissenschaftsideal – wider besseres Wissen, wider datengestützte Evidenz, wider anerkannte Theorien, wider ethische Normen. Damit wird die Illusion geschaffen, eine bestehende Inkongruität von subjektivem Verlangen und objektivem Sachverhalt aufgehoben und die davon ausgelöste kognitive Diskrepanz beseitigt zu haben. Hinter der Entdeckung des Piltdown-Menschen stand als Motiv die viktorianische Ideologie nationalkultureller Größe, fixiert auf die symbolische Rolle eines (vermeintlich) bedeutsamen Fossilienfundes. Die Entdeckung hätte, wäre der Fund authentisch gewesen, nachhaltig nationalen Stolz und wissenschaftliche Genugtuung ausgelöst. Unstimmigkeit („England hat paläologisch nicht genug zu bieten“) hätte sich in Stimmigkeit („Engländer haben urzeitlich bedeutsame Vorfahren“) verwandelt. Im Grunde haben wir es mit einer besonderen Spielart menschlichen Harmoniebedürfnisses zu tun, das nur leider nicht im Dienst wissenschaftlicher Wahrheitsfindung steht, sondern im Interesse ideologischer Überzeugung, persönlicher Geltungssucht und narzisstischer Neigung.4
Plagiat und Täuschung in der Wissenschaft sind strafrechtlich nicht belangbar
Manipulation unter dem Diktat persönlicher Geltungssucht charakterisiert auch den folgenden, unlängst in Deutschland registrierten Fall: Dem renommierten Krebsforscher Friedhelm Herrmann, ehedem ärztlicher Direktor an der Universi- tätsklinik Ulm, und seiner vormaligen Assistentin Marion Brach wurde 1997 Forschungsfälschung in „beispiellosen Umfang“ vorgeworfen.5 Die Vorwürfe reichten vom freien Erfinden von Abbildungen, Tabellen und Daten über Manipulation und Fälschen experimenteller Befunde bis hin zu unverfrorenem Plagiat. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) setzte eine Untersuchungskommission ein, die „37 gefälschte oder mit großer Wahrscheinlichkeit gefälschte Veröffentlichungen“ identifizieren konnte. In der Presse war die Rede von einem „GAU in der Forschung“. Die Staatsanwaltschaft ermittelte gegen den skrupellosen Professor, der bis zu seiner Diskreditierung als herausragende Persönlichkeit unter den deutschen Gentherapeuten galt. Fast 400 Publikationen wurden unter seinem Namen veröffentlicht; über eine Million DM an Forschungsgeldern flossen seinem Team von der Deutschen Krebshilfe und aus anderen Quellen zu.
Die Skrupellosigkeit dieses „schwarzen Schafes“ unter den Forschern geht beispielhaft aus Ereignissen hervor, die auf einen schweren Fall von geistigem Diebstahl hinweisen: Im Sommer 1984 hatte Herrmann an einem Krebsforscher-Kongress in München teilgenommen, auf dem japanische Wissenschaftler ein Experiment zum Problem so genannter Genshifts (i. e. genverändernde Effekte evolutionärer Selektion) vorführten. Im November desselben Jahres begann auch Herrmanns deutsches Team experimentell an diesem Problem zu arbeiten: Im Januar 1995 veröffentlichten die Japaner ihre Ergebnisse, und kurz darauf erschien im Februar 1995 auch ein diesbezüglicher Artikel der Deutschen mit erstaunlich identischen Resultaten. Verräterisch war, dass ihr wissenschaftlicher Aufsatz bereits am 3. Oktober der Zeitschrift Strahlentherapie und Onkologie eingereicht worden war, also bevor sich die Gruppe überhaupt mit dem Projekt beschäftigen konnte. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit entstammten die veröffentlichten Resultate aus der auf dem Kongress vorgestellten japanischen Forschung. Hätten Herrmann und Mitarbeiter erst nach dem Vorliegen eigener Ergebnisse deren Veröffentlichung zustande gebracht, so hätten diese nur die Resultate der Japaner bestätigen können. Ihr Artikel wäre wegen mangelnder Originalität zu unbedeutend gewesen, um in der Fachwelt Aufmerksamkeit zu erregen. Also bediente man sich bei der Konkurrenz, um eigenen Ruhm zu ernten. Durch die Entlarvung seiner Machenschaften war Herrmann blamiert und wurde zu einem Paria in der Wissenschaft. Doch juristisch belangt wurde er nie, denn Plagiat und Täuschung in der Wissenschaft sind strafrechtlich nicht belangbar. Nach wie vor führt Herrmann seinen Professorentitel und betreibt als niedergelassener Onkologe eine Praxis in München.
Ginge es nach Verhaltenskodizes, die international gültig und allen Forschern grundsätzlich bekannt sind, käme Betrug in der Wissenschaft nicht vor. Das Ethos dieser Berufsgruppe ist klar genug; das ständische Gebot, Wissenswachstum unter reellen Bedingungen zu fördern, eindeutig genug, um Fehldeutungen in der Auslegung oder Willkür in der Anwendung – theoretisch – auszuschließen. Der Biologe Hans Mohr hat normative Prinzipien und Verhaltenskodizes für Wissenschaftler formuliert6 und sie in fünf Kategorien eingeteilt:
- die Grundannahme, dass die Welt real und erkennbar ist, dass ihre Gesetze vermittels der Logik und Mathematik analysierbar sind und dass es keinen Bruch im Kausalnexus der Wirklichkeit gibt;
- die Grundvoraussetzung, dass es Gedankenfreiheit gibt und dass daraus die Freiheit der Forschung sowie der Selbstwert wissenschaftlicher Erkenntnis abzuleiten sind;
- die Normen fairer Konkurrenz, wodurch Vorurteilslosigkeit und Fairness gegenüber Fachkollegen sowie gegenseitige Verlässlichkeit und Redlichkeit im Wissenschaftsbetrieb zu gewährleisten sind;
- die Normen der Ehrlichkeit, welche Glaubwürdigkeit (beim eigenen Verhalten), Offenheit (gegenüber abweichenden Überzeugungen oder Lehrmeinungen), Stetigkeit (beim Verfolgen von Problemlösungen), Wahrhaftigkeit (bei der Präsentation und Interpretation von Befunden) sowie Bereitschaft zum Umdenken (bei „unbequemen“ Alternativen) einschließen;
- die Normen der methodischen Sorgfalt, d. h. Genauigkeit im Umgang mit Daten, Gewissenhaftigkeit beim Prüfen von Ergebnissen, Eindeutigkeit im Gebrauch von Sprache und Notationssystemen, Klarheit in der Darstellung der Vorgangsweise, Explizitheit bei der Erläuterung von Prämissen sowie größtmögliche Einfachheit bei der Theorie- und Konstruktbildung.
Wissenschaft ist per se kein Garant für moralische Integrität
Mohr ist davon überzeugt, dass es sich bei der Beachtung und Anwendung des Normensystems um ein strenges, in der Praxis bewährtes Regiment handelt, das Missbrauch weitgehend verhindert und Verstöße wirkungsvoll zu ahnden imstande ist. Aber er ignoriert die Dunkelziffer bei akademischen Missetaten und unterschätzt das Ausmaß des Schadens, der durch Betrügereien angerichtet wird. Wenn seine Normen im Alltag der Forschung missachtet werden, so nicht deshalb, weil sie unbekannt, unanwendbar oder unzulänglich wären, sondern weil sie absichtsvoll verletzt werden, denn es gibt systemimmanente Faktoren im heutigen Wissenschaftsbetrieb, die solche Verletzungen begünstigen. Zwar gilt als fraglos, dass die Ideale der Wissenschaft (Wahrheitsfindung, Erkenntnisfortschritt, Nutzanwendung oder was immer man als ihr Anliegen definiert) an die Beachtung von Regeln gebunden sind. Man weiß auch, dass ihre Missachtung empfindliche Störungen im Wissenschaftsprozess (Kontroversen, Rechtsstreitigkeiten, Blamagen, Rufschädigung, Vertrauensverlust) auslösen kann. Sie zu vermeiden, entspricht daher dem Interesse der gesamten Zunft wie auch dem der Öffentlichkeit. Doch was dieses Interesse oft untergräbt, sind Verlockungen und Versuchungen, die dem Wissenschaftsbetrieb selbst immanent sind und institutionell die spezifischen Ambitionen und Karrierewünsche von Forschern fördern: schneller Aufstieg auf der Karriereleiter, hohes Ansehen in der scientific community, Aussichten auf Forschungsgelder, üppige Ausstattung von Labor- und Arbeitsräumen, großer Stab von Mitarbeitern, Gewinn von Wissenschaftspreisen, positive Referenzen in Fachpublikationen, Einladungen zu Kongressen, Auftritte als gefragte Gastredner, Sensationsmeldungen in den Medien oder eine finanziell lukrative Berufung an renommierte Universitäten oder Institute.
Der Fall Herrmann mag als ein Fall exzeptioneller Unverfrorenheit erscheinen, ist aber keineswegs singulär. Die Wissenschaftsjournalisten Marco Finetta und Arnim Himmelrath haben eine Art chronique scandaleuse der letzten Jahrzehnte zu dem Problem verfasst. In ihrem erwähnten Buch „Der Sündenfall“ kommen sie zu einem vernichtenden Urteil, sprechen gar von einem „Triumphzug“ des wissenschaftlichen Betrugs im 20. Jahrhundert und machen Dutzende skandalöser Fälle publik. Vor allem die siebziger und achtziger Jahre seien eine Blütezeit der wissenschaftlichen Fälscher gewesen und hätten aus Deutschland wie aus den USA immer neue Kunde von spektakulären Fällen gebracht. Wie die Autoren exemplarisch berichten: Sensationelle Fortschritte im Kampf gegen den Krebs hatten sich ebenso als Fälschung entpuppt wie neue Behandlungsmethoden bei Herzinfarkt und psychischen Erkrankungen; Versuchspersonen und -ergebnisse wurden reihenweise erfunden; Laborexperimente im großen Stil manipuliert: Mal hatten die Fälscher falsche Zellkulturen verwendet, um Therapieerfolge bei Affen als solche bei Menschen auszugeben; mal hatten sie das Fell weißer Mäuse mit schwarzem Filzstift bemalt, um die Verträglichkeit neuer Immunstoffe bei Gewebetransplantationen zu belegen. Korruption gibt es nicht nur, wie oft angenommen, auf dem politischen und wirtschaftlichen Sektor, sondern auch auf dem Feld der Wissenschaft.
Wissenschaftler sind Menschen und, sieht man von ihrer besonderen Begabung und Interessenlagen ab, sind sie, da zur menschliche Spezies gehörig, grundsätzlich mit allen Stärken und Schwächen ausgestattet, die ihnen Natur und Sozialisation mit auf den Weg gegeben haben − mit allen Gefühlen, Leidenschaften, Neigungen und Veranlagungen, die wir auch bei anderen Exemplaren des homo sapiens finden. Wissenschaft ist per se kein Garant für moralische Integrität. Doch mehr als andere Berufsgruppen stehen Wissenschaftler im harten Wettbewerb, denn der Fortschritt der Wissenschaft lebt nicht nur vom geistigen Format der Forscher, sondern auch von fachlich-intellektueller Konkurrenz. Ohne Wissensdurst, ohne Neugier, ohne Ehrgeiz können sie keine fachlichen Erfolge verzeichnen. Doch diese idealtypischen „Tugenden“ haben eine Kehrseite, wo die Positiva in Negativa umschlagen können – in Neid, Profilierungssucht, Rechthaberei, Intoleranz, Dogmatismus, ideologische Voreingenommenheit. Eine pure, gewissermaßen „außermenschliche“ Wissenschaft gibt es nicht, und so gehört auch der Streit zu den Phänomenen, die wir in der Wissenschaftsgeschichte reichlich vorfinden. Da es zwar Übereinkünfte, Konsensfelder und Paradigmen gibt, aber keine absolute Wahrheit, ist Streit unvermeidbar ein Teil des wissenschaftlichen Lebens. Er manifestiert sich auf einem Spektrum zwischen fruchtbaren Diskussionen und pöbelnden Invektiven.
Ein vehementer Streit, der jahrzehntelang nicht nur die einschlägigen Wissenschaften, sondern die internationale Öffentlichkeit beschäftige, war die Kontroverse über die in den Jahren 1947 bis 1956 in Höhlen am Toten Meer entdeckten antiken Schriftrollen.7 Sie wurden in der Nähe der Ruinen der Siedlung Khirbet Qumran gefunden, die von ihren Bewohnern, mutmaßlich Essenern, im ersten Jahrhundert n. Chr. infolge von Kriegseinwirkung (römische Invasion anno 68) aufgeben worden war. Bei den Rollen handelte es sich um brisantes Material. Es wurde von Fachleuten, Archäologen und Theologen, geprüft und als so „gefährlich“ angesehen, dass eine internationale Expertengruppe unter der Ägide von Pater Roland de Vaux die Rollenfunde jahrelang zurückhielt. Er machte die Funde zur „Verschlusssache“,8 obwohl namhafte Fachleute im ganz Europa und den USA ständig auf ihre Veröffentlichung drängten. Die Brisanz der auf Hebräisch verfassten, über 800 (teils fragmentierter und zerfallener) Rollen steckt darin, dass sie bislang unbekannte Texte über das Leben und religiöse Credo einer (möglichen) Urchristengemeinde enthielten. Das dokumentierte Ethos der Gemeinde von Qumran entspricht in Grundzügen dem Geist der frühen Christen, und die Texte weisen zum Teil verblüffende Übereinstimmungen mit den Evangelien auf. Es spielt dort ein „Lehrer der Gerechtigkeit“ eine prominente Rolle, der, wie einige mutmaßen, mit Jesus Christus identisch war oder gewesen sein könnte. Es werden heilige Riten wie Taufen, Gebete und gemeinsame Mahle beschrieben, wie wir sie im Neuen Testament wiederfinden, nur dass man die Zeit der Qumran-Gemeinde auf die drei vorchristlichen Jahrhunderte datiert hat, also erheblich früher als die Anfänge des Christentums. In dieser Datierung steckt der „Explosivstoff“ der Texte. Denn wenn die Essener der Qumran-Gemeinde (oder -Sekte) einen christlichen Lebensstil praktizierten und einen entsprechenden Glauben pflegten, lange bevor die Christen der Jerusalemer Urgemeinde um Paulus und Jakobus sich formierten, dann müsste das Evangelium revidiert und über Strecken neu geschrieben werden. Es verlöre seine Originalität, und die Gelehrten wären gezwungen, die Religionsgeschichte, insbesondere die Christologie, neu zu verfassen. Der Jesus Christus der Bibel wäre womöglich nicht mehr einzigartig – eine Horrorvorstellung für alle Dogmatiker unter den Theologen.
… der für Ideologen typischen Devise, dass nicht sein kann, was nicht sein darf
Den Kern der Auseinandersetzung um die Rollen haben die Religionskritiker Michael Baigent und Richard Leigh auf den Punkt gebracht: „Das Christentum beharrt auf der Einzigartigkeit Jesu, während die Schriftrollen diesen Anspruch infrage stellen. Sie schildern Ereignisse und Haltungen aus den frühen Entwicklungsjahren des Christentums, die nicht durch spätere theologische und dogmatische Standpunkte verzerrt wurden. […] Das Christentum entstand nicht durch ein einzigartiges, beispielloses Ereignis in der Geschichte der Welt, wie es das vatikanische Dogma uns glauben machen will. Im Gegenteil, es entwickelte sich aus einer bereits existierenden Bewegung, welche die Texte, die wir als Schriftrollen vom Toten Meer kennen, hervorbrachte.“9
Wegen der „drohenden Gefahr“ einer eventuell fälligen Revision der christlichen Religionsgeschichte regten sich Unruhe und Befürchtungen in der Arbeitsgruppe, insbesondere bei Pater de Vaux. Er war ein überzeugter Katholik, der sich zum mächtigen Sprachrohr der Gegner der Christlichkeitsthese berufen fühlte und offenbar im Auftrag des Vatikans handelte. Der Pater wähnte sich im Besitz der Wahrheit, bestritt energisch die Analogien zum Frühchristentum und beanspruchte eifersüchtig die Deutungshoheit über die Rollen. Er handelte nach der für Ideologen typischen Devise, dass nicht sein kann, was nicht sein darf. Mit endlosen Ausflüchten und an den Haaren herbeigezogenen Argumenten verstand es de Vaux, die angekündigte Publikation der übersetzten Texte immer wieder zu verzögern, so dass es in der Fachwelt bald zu starker Verärgerung über die Dilatorik kam. Nicht nur in der Fachliteratur, sondern auch in der internationalen Presse wurde über den Streit berichtet. Da Khirbet-Qumran in einer felsigen Grenzregion zwischen Israel und Westjordanien liegt, schalteten sich sogar die beiden Staatsregierungen mit eigenen Ansprüchen in den Konflikt ein. Die Schriftrollen wurden zum Politikum. Was ein allen qualifizierten Forschern und Interessenten zugängliches kulturelles Erbe der Menschheit hätte sein sollen, wurde zu einem Zankapfel, der das wissenschaftliche Ethos der Streithammel kompromittierte. Es dürfte kaum ein besseres Exempel für die Unsinnigkeit und Schädlichkeit wissenschaftlicher Streiterei geben als den Kasus Qumran.

Qumran-Schriftrollen: Dogmen in der Wissenschaft blockierten über Jahrzehnte hinweg eine sachliche Einordnung des Sensationsfunds (Quelle: Wikimedia Commons)
Inzwischen ist der Streit verebbt, obwohl ein Konsens der Gelehrten nie erzielt wurde, und Fachleute sich immer noch an den Rollen abarbeiten. Die inzwischen (teilweise) restaurierten und konservierten, auf Mikrofiches oder Faksimiles übertragenen Rollen bzw. deren Übersetzungen liegen auf dem Globus verstreut in Museen in Haifa, Paris und Washington, D. C. Aber: Eine überkonfessionell akzeptierte und wissenschaftlich anerkannte Gesamtdarstellung gibt es nicht. Qumran ist für manche ein Rätsel, für andere ein Ärgernis und für wieder andere eine Offenbarung.
ANMERKUNGEN
- E. Noelle-Neumann: Wissenschaft in der öffentlichen Wahrnehmung: Ergebnisse einer Allensbach-Umfrage. In: Forschung und Lehre 5/1999, S. 228-232
- William Broad/Nicholas Wade: Betrug und Täuschung in der Wissenschaft. Basel 1984, S. 147 ff.
- Vgl. John E. Walsh: Unraveling Piltdown. The Science Fraud of the Century and its Solution. New York 1996
- Hartmut Heuermann: Wissenschaftskritik. Konzepte, Positionen, Probleme. Tübingen 2000, S. 263 ff.
- Vgl. Vera Zylka-Menhorn: Forschungsbetrug – Fall Hermann/Brach. Deutsches Ärzteblatt 42/1997; Ernie Esquivil: Ein Gefühl der Desillusionierung: Innenansichten der Forschungsgruppe Herrmann Brach. In: Forschung und Lehre 8/2000; s. a. Marco Finetta/Arnim Himmelrath: Der Sündenfall: Betrug und Fälschung in der deutschen Wissenschaft. Stuttgart 1999, S. 33 ff.
- Hans Mohr: Homo investigans und die Ethik in der Wissenschaft. In: Wissenschaft und Ethik, hrsg. v, Hans Lenk, Stuttgart 1991, S. 31-61
- Einige der Schriftrollen sind in deutscher Übersetzung veröffentlicht und kommentiert von Michael Wise u. a.; Die Schriftrollen von Qumran. Augsburg 1997
- Vgl. Michael Baigent/Richard Leigh: Verschlusssache Jesus: Die Wahrheit über das frühe Christentum. Bergisch Gladbach 2006
- Verschlusssache Jesus, S. 327-328
Diese Beiträge könnten Sie auch interessieren:
zeitgeist-Suche
Für mehr freien Journalismus!
Buchneuerscheinungen
Unser Topseller
Buch + DVD als Bundle!
Frisch im Programm
Aus unserer Backlist
Meist gelesene Onlinebeiträge
- Das Guttenberg-Dossier (Teil 1)
- Tetanus-Impfung: Mythen und Fakten
- Avaaz.org und der geheime Informationskrieg um Syrien
- Das Guttenberg-Dossier (Teil 2)
- Als trojanischer Esel der NATO in den Dritten Weltkrieg
- Enthüllt: Femen
- Der amerikanische (Alb-)Traum
- Der Neffe Freuds – oder: wie Edward Bernays lernte, die Massen zu lenken
- Putsch in Berlin?
- "Double Dip": vom Zusammenbruch unseres Finanzsystems